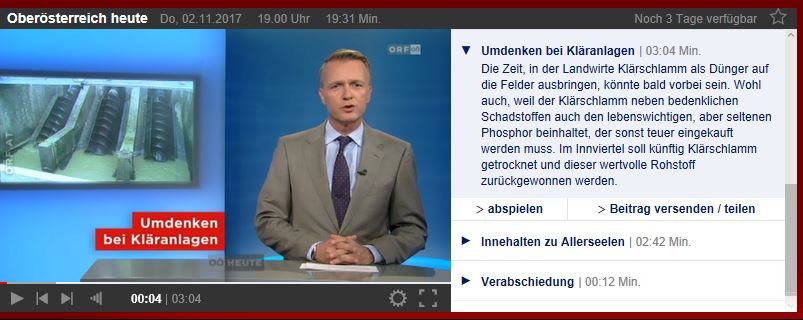am Donnerstag, den 2.11.2017 wurde folgender Beitrag zum Thema Klärschlamm in „Oberösterreich heute“ gesendet:
Alleine die Einführung in den ORF-Beitrag erweckt den Eindruck, dass die Düngung mit Klärschlamm eine Gefahr für den Boden darstellt und die Lösung für die Zukunft mit der Klärschlammtrocknung und Phosphorrückgewinnung gefunden wurde. In der Folge können sie in schwarzer Schrift die klärschlammrelevanten Textstellen des ORF-Beitrages nachlesen. Jeweils darunter finden Sie meinen Kommentar in grüner Farbe:
ORF:
Die Zeit, in der die Landwirte Klärschlamm als Dünger auf die Felder ausbringen könnte bald vorbei sein. Wohl auch, weil der Klärschlamm neben leider bedenklichen Schadstoffen auch den lebenswichtigen aber seltenen Phosphor beinhaltet, der sonst teuer eingekauft werden muss.
Im Innviertel soll deshalb künftig Klärschlamm getrocknet und dieser wertvolle Rohstoff (Anm. Phosphor) rückgewonnen werden.
Der Schlamm ist trotz Reinigung immer noch schadstoffbelastet, etwa mit Schwermetallen, Viren und Wurmeiern. Deshalb fällt der Preis für Klärschlamm als Dünger.
Gerade die nachhaltige Landwirtschaft verlangt nämlich nach immer hochwertigeren Produkten, wie getrocknetem Klärschlamm, der mit einer Solartrocknungsanlage erzeugt wird. Dafür wurde heute eine Machbarkeitsstudie für das Innviertel präsentiert.
Kommentar Müller:
In Österreich wurde in den vergangenen Jahrzehnten hervorragende Arbeit geleistet um die Schadstoffeinträge in das Abwasser zu reduzieren. Nicht zuletzt haben alle Industrie- und Gewerbebetriebe durch die Umsetzung von Indirekteinleiterverordnung und branchenspezifischen Abwasseremissionsverordnungen zu einer deutlichen Schadstoffreduktion beigetragen. Die Schwermetallgehalte vieler Klärschlämme entsprechen heute der Kompost-Güteklasse A+, die die Grenzwerte für den Biolandbau festlegt. Dementsprechend hoch ist die Akzeptanz für die direkte landwirtschaftliche Klärschlammverwertung bei gut informierten Kläranlagenbetreibern und Landwirten.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Feststellung im ORF-Beitrag, dass künftig im Innviertel der wertvolle Rohstoff Phosphor rückgewonnen werden soll. Der RHV Braunau verwertet seit 2004 den gesamten Klärschlamm in der Landwirtschaft und stellt damit sicher, dass der enthaltene Phosphor im Rahmen der sachgerechten Düngung zu 100 % der Pflanzenernährung zugeführt wird. Im selben Ausmaß, in dem Phosphor über Klärschlamm als Dünger in den Boden gelangt, kann auf Phosphorimporte verzichtet werden. Außerdem gelangen über Klärschlamm noch alle anderen „wertbestimmenden Inhaltstoffe“ wie Stickstoff, Kalium, Kalk, Spurenelemente und organische Substanz in den Boden und tragen im Rahmen einer professionellen Düngeplanung zu einer ausgewogenen Nährstoffversorgung von Boden und Pflanzen bei.
Die nachhaltige Landwirtschaft sollte verstärkt regionale Ressourcen nutzen. Leider gibt es im Vertragsanbau einige Klärschlammverbote (AMA-Gütesiegel, Rapso, …) die die Frage der Nachhaltigkeit nicht berücksichtigen sondern ausschließlich den „Konsumentenwunsch“ berücksichtigen. Der „Konsumentenwunsch“ wird aber durchwegs von „Werbefachleuten“ formuliert. Ein Verbot des Klärschlammeinsatzes betrifft in allen Fällen jede Form von Klärschlamm. Egal ob er flüssig, entwässert, getrocknet oder kompostiert ausgebracht wird.
Obmann Günter Weibold:
Man sieht´s ja schon auch in der intensiven Milchviehhaltung, dass er dort nicht mehr ausgebracht werden kann, Salzburg zum Beispiel, und vor allen Dingen sollte ja der Phosphor auch wieder für die Landwirtschaft verfügbar gemacht werden und das war unsere Intention diese Studie zu machen.
Kommentar Müller:
Gerade in der intensiven Milchviehhaltung kommt es zu Phosphormangel, wenn nicht regelmäßig Phosphor gedüngt wird. Das Beispiel Salzburg veranschaulicht deutlich, dass nicht die Frage der Nachhaltigkeit für die Entscheidung über den Klärschlammeinsatz in der Landwirtschaft ausschlaggebend war. Als die Klärschlamm-Bodenschutzverordnung mit dem KIärschlammverbot im Jahr 2001 im Entwurf vorlag, habe ich mit Landesrat Raus telefoniert welcher das Verbot damit begründete, dass Salzburg zum „Bio-Musterland“ werden soll. Auf meinen Einwand hin, dass dann Phosphor verstärkt mineralisch importiert werden muss hat er geantwortet, dass das „den Konsumenten“ nicht interessiert. Die Rahmenbedingungen in Salzburg verhindern dementsprechend die Anwendung von Klärschlamm, egal ob er getrocknet ist oder nicht. Die Rahmenbedingungen in Oberösterreich erlauben den Klärschlammeinsatz und dementsprechend ist der Phosphor für die Landwirtschaft verfügbar!
ORF:
Ziel ist es, das Wasser aus dem Klärschlamm zu bekommen, statt 70 % sind es dann nur noch 15 %, damit ist der Schlamm leichter zu transportieren und der Dünger ist schadstofffrei. Geht es nur um den Phosphor lässt sich das Gewicht als Asche sogar auf ein Hundertstel reduzieren.
Kommentar Müller:
Die Behauptung, dass Klärschlamm durch Trocknung schadstofffrei wird, ist symptomatisch für die fachliche Qualität des ORF-Beitrages.
DI Günter Knoll:
Phosphor ist deshalb wichtig, weil die Gewinnung des Phosphors aus Lagerstätten kommt die sowohl verunreinigt sind, aus unsicheren Ländern stammt und der Phosphor im Klärschlamm soweit ausreichend zur Verfügung steht, dass es ein Muss ist diese Ressource zu sichern.
Kommentar Müller:
Phosphor wird aus Erzen gewonnen, die teilweise in politisch labilen Ländern liegen. Informationen zu den Auseinandersetzungen in Marokko, wo es zu Kämpfen mit der Polisario kam und kommt, sind im Internet zu finden (z.B. http://www.wsrw.org/a190x1455 ). Europa verfügt über keine nennenswerten Lagerstätten und ist auf Importe angewiesen. Da Rohphosphate mit Cadmium und Uran verunreinigt sind, sind auch Phosphatdüngemittel mit diesen Schwermetallen belastet. Die erlaubten Cadmiumfrachten im Düngemittelrecht, bezogen auf Reinphosphat, liegen deutlich über den Frachten, die zum Beispiel über den Klärschlammeinsatz für dieselbe Menge Phosphat auf den Boden gelangen. Grenzwerte für Uran in Phosphatdüngemitteln existieren bis jetzt nicht. Momentan steigt jedoch das Interesse der Düngemittelindustrie an Klärschlammaschen, weil die Cadmiumgrenzwerte durch das EU-Düngemittelrecht abgesenkt werden sollen. Klärschlammaschen enthalten deutlich weniger Cadmium als Phosphaterze und könnten als Verdünnungsmittel herangezogen werden. Sollte die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm und Klärschlammkompost verboten werden ist jedenfalls zu erwarten, dass die Entsorgungskosten für die Kläranlagenbetreiber steigen und der Preis für die Phosphorversorgung für die Landwirte deutlich höher wird. Voraussetzung für die Gewinnung von Phosphor aus Klärschlamm ist in jedem Fall eine thermische Behandlung (z.B. Verbrennung oder Pyrolyse) und die nachfolgende Behandlung der Behandlungsrückstände (Asche oder Pyrolysekohle) in einer Chemiefabrik. Hierbei ist es unerheblich, ob Verbrennungs- und Chemieanlagen im Innviertel oder andernorts entstehen. Der CO2 Ausstoß und der Chemieeinsatz sind in jedem Fall höher als bei der direkten landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlamm oder Klärschlammkompost.
ORF:
Als Leader-Projekt unter Einbindung der Nachbargemeinden und als Kooperation mit einem Betreiber scheint auch ein Finanzierungsmodell gefunden zu sein, das der Bevölkerung auf lange Sicht überschaubare Kanalgebühren garantiert. Von einer, seitens des Bundesabfallverbandes angedachten Lösung, Klärschlamm in Niederösterreich zu verbrennen, hält man hier wenig.
Kommentar Müller:
Eine Studie, die die Potentiale für zusätzliche Behandlungsschritte für Klärschlamm im Innviertel aufzeigt, ist äußerst begrüßenswert! Leider wird bei vielen „innovativen Projekten“ suggeriert, dass die Kosten für die Kanalbenutzer überschaubar bleiben, indem nur einige Cent pro m³ Abwasser veranschlagt werden. Kaum ein Kanalbenutzer kennt die gesamte Kubatur an Abwasser, die in die Kläranlage gelangt. Tatsache ist, dass auch bei Kosten von wenigen Cent pro m³ hohe Kosten auf die Kläranlagenbetreiber zukommen können.
Ein Bundesabfallverband existiert in Österreich nicht und so gesehen stellt sich auch die Frage wer das Ziel haben soll, eine zentrale Klärschlamm-Verbrennungsanlage in Niederösterreich aus dem Innviertel zu beliefern. Aktuell existiert die Verbrennungsanlage der Stadt Wien, die Klärschlamm einer Mono-Verbrennung unterziehen kann um den Phosphor in der Asche für eine weitere Verwertung zu erhalten. Die Verbrennungsanlage in Bad Vöslau, die den getrockneten Klärschlamm nach der solaren Trocknung verwerten sollte, wurde aus technischen und wirtschaftlichen Gründen stillgelegt.
Obmann Günter Weibold:
Wenn ich jetzt zum Beispiel Klärschlamm, ich sag jetzt einmal durch die Republik führe, dann führe ich 70 % Wasser auf unseren Straßen herum. Das war auch eine Überlegung warum man dezentral und regional diese Verwertung durchführen sollte.
Kommentar Müller:
Der Vorteil der regionalen Verwertung von Klärschlamm liegt auf der Hand. 70 % Wassergehalt bedeutet, dass 1 Tonne Klärschlamm aus 700 kg Wasser und 300 kg Trockenmasse besteht. Die Frage ist immer wieder zu stellen, ob es langfristig wirtschaftlicher ist, den abnehmenden Landwirten den Transport des Wassers zu vergüten oder technische Anlagen zu errichten, die den Wassergehalt reduzieren. In Österreich existieren seit längerem solare Trocknungsanlagen. Ein Beispiel dafür ist die Anlage in Friesach-Althofen, wo nach den ersten Erfahrungen mit der Ausbringung von getrocknetem Klärschlamm derzeit wieder der meiste Klärschlamm in entwässerter Form verwertet wird. Die Probleme bei der Ausbringung von getrocknetem Schlamm waren einerseits die mangelnde Verteilgenauigkeit und andererseits die Staubbelastung durch die verfügbaren Streuer. Landwirte und Maschinenringe haben in den letzten Jahrzehnten Ausbringungsgeräte angeschafft, die in der Lage sind entwässerten Klärschlamm exakt auszubringen.
ORF:
Die geplante Klärschlammtrocknung im Innviertel steht modellhaft für ganz Österreich, doch auch im benachbarten Bayern bleibt die Zeit nicht stehen. Dort wird massiv in die neue Technologie investiert.
Kommentar Müller:
Solare Klärschlammtrocknung wird in Österreich schon seit längerem praktiziert. Mit dem Suchbegriff „Klärschlamm solare Trocknung Österreich“ können Sie sich im Internet einen Überblick über verschiedene Anbieter und realisierte Projekte in Österreich verschaffen. Jede Trocknung führt natürlich zu einer deutlichen Gewichtsreduktion. Das Allheilmittel für alle Probleme ist damit jedoch nicht gefunden. Abhängig von Standort und Beschaffenheit des Klärschlammes kann es zu Geruchsproblemen in der Anlage und wie oben genannt zu Problemen bei der Ausbringung kommen.
Der Beitrag, der am 2.11.17 vom ORF ausgestrahlte wurde, ist fachlich nicht nachvollziehbar. Es stellt sich die Frage, warum für die Präsentation einer Studie, die mit öffentlichen Geldern gefördert wird, so viel Verunsicherung bei Kläranlagenbetreibern, Landwirten und Bevölkerung geschürt werden muss. Es war und ist nach wie vor aufwendig sachliche Argumente für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm überall dort vorzubringen, wo Verunsicherung über die Sinnhaftigkeit dieser effizienten Verwertungsschiene herrscht. Das ÖWAV-Positionspapier zur Ressource Phosphor hat deutlich aufgezeigt, dass bis dato ausschließlich über die sachgerechte Düngung mit Klärschlamm und Klärschlammkompost ein effektives Recycling betrieben wird. Gerade in Oberösterreich hat die sachgerechte Düngung mit Klärschlamm eine lange und erfolgreiche Tradition, die durch die gegenständliche, reißerische Reportage gefährdet wird.
Es ist nur zu gut verständlich, dass aufwendige, technische Lösungen im Interesse von bestimmten Gruppen liegen. Es hat sich jedoch in der Vergangenheit gezeigt, dass innovative Projekte wie z.B. zur Mono-Verbrennung, Co-Vergärung, Klärschlamm-Vererdung oder Eindickung von Flüssigschlamm mit Drainage-Elementen nicht immer vom gewünschten Erfolg gekrönt waren. Jeder Kubikmeter Klärschlamm, der bis jetzt im Rahmen einer professionellen Düngeberatung in der Landwirtschaft verwertet wurde, konnte jedoch sein volles Potential zur Ressourcenschonung entfalten. Dieses Potential kann auch zukünftig genutzt werden, wenn die Rahmenbedingungen dafür erhalten bleiben und das Vertrauen aller Beteiligten bestehen bleiben. Ich werde mich mit meinen Mitarbeitern auch weiterhin bemühen gute Argumente auf Basis abgesicherter Forschungs- und Praxiserkenntnisse zu präsentieren und das Vertrauen, das durch fachlich unqualifizierte Angriffe auf die bestehende Verwertungspraxis zunichte gemacht wird, wieder herzustellen.